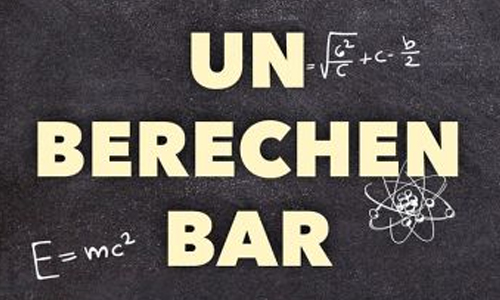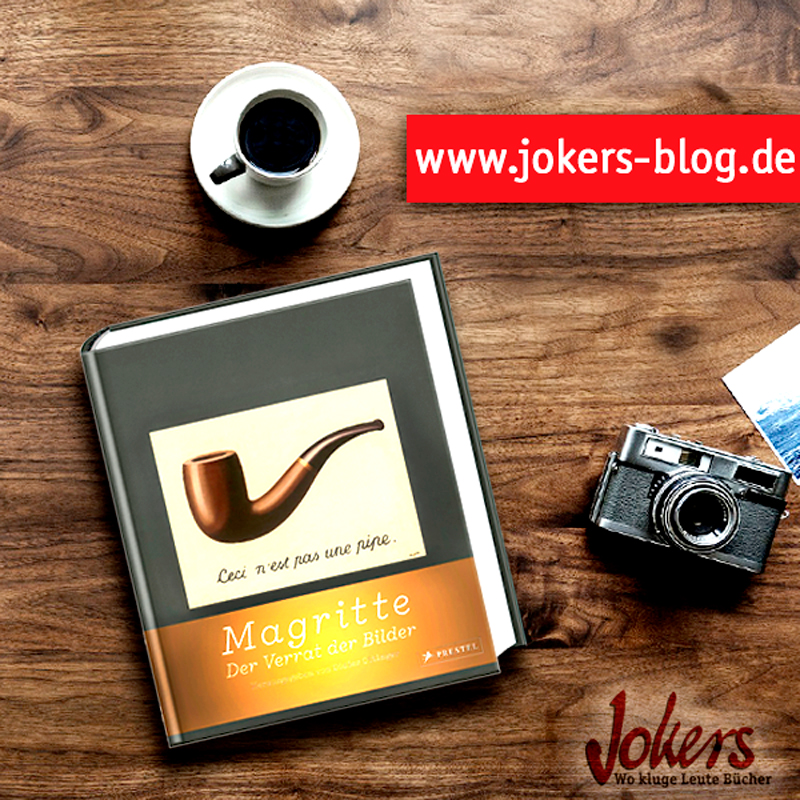
Anlässlich der Ausstellung des Surrealisten René Magritte im Jahr 2017 in der Schirn Kunsthalle Frankfurt 2017 wurde „Der Verrat der Bilder“ publiziert
Der Maler Renée Magritte (1898-1976) ist eine Schlüsselfigur der Malerei des 20. Jahrhunderts. Als Künstler des Surrealismus, der immer wieder Kunst und Philosophie seiner Zeit zusammenbrachte, ging er seinen eigenen Weg. Obwohl das Wort Künstler in Bezug auf Magritte wohl eher Ansichtssache zu sein scheint:
„Ich bin kein Künstler, ich bin ein denkender Mensch, der seine Gedanken durch die Malerei vermittelt“ – Renée Magritte
Magritte arbeitete sein Leben lang daran, der Malerei eine
den Worten gleichrangige Bedeutung zu geben. Er wollte die Diskrepanz zwischen
Bild und Sprache hervorheben. Dieses
Konzept zieht sich durch den ganzen Essayband.
Den Anfang macht die allseits bekannte und beliebte Zeichnung: „Les mots
et les images“. Das Bild zeigt eindeutig eine Pfeife und verneint dies
gleichzeitig mit der Aussage „Ceci n’est pas une pipe“ (Dies ist keine Pfeife).
Magritte meint damit, dass dies das Abbild einer Pfeife ist und keine reale
Pfeife.
Er macht damit nicht nur auf den Kontrast zwischen Abgebildetem und Abbild
aufmerksam, sondern auch auf das komplexe Beziehungsgefüge zwischen Text, Bild
und Gegenstand.
Das ist auch das Trügerische an Magrittes Kunst, denn nur durch simple
Benennung ist der Gegenstand nicht gleich Gegenstand. Die Bildtitel
identifizieren nicht seine Bildwelten, sondern verschlüsseln sie zusätzlich.
„Der
Maler René Magritte ist ein Magier der verrätselten Bilder“
Die Stoßrichtung des Surrealismus ist klar: Es geht gegen das rationale
Denken, denn das hat der Welt gerade den ersten Weltkrieg beschert. Es sollen
die Tiefen des Unterbewusstseins ausgelotet werden und so ist es kein Wunder,
dass sich auch Magritte beeindruckt von zeitgenössischen Philosophen zeigt. Durch das bebilderte Werk ziehen sich fünf bekannte Motive: Feuer,
Schatten, Wörter und der fragmentierte Körper. Durch ausgesuchte Abbildungen,
die perfekt auf die Thematik abgestimmt sind, wird Magrittes Umgang mit diesen
Motiven detailreich erläutert. Auch kluge Essays mit Beispielen helfen dem
Leser sich an diese philosophische Seite der Kunst heranzutasten und sie zu
hinterfragen. Selbst Werke gegenwärtiger Künstler wie Banksys „Choose your
weapon“, werden genannt und verdeutlichen immer wieder Magrittes Sichtweise.
„Zusammenwirken
zwischen gemalter und realer Welt, das sich so oft im Werk von Banksy findet,
wäre im Übrigen ohne Magritte kaum vorstellbar“
Der abschließende Teil des Buches gibt Einblick in Magrittes
philosophische Künstlerpersönlichkeit. „Korrespondenz“ zeigt den Austausch des
Belgiers mit renommierten Philosophen wie Alphonse De Waelhens, Michel Foucault
oder auch Chaim Releman. Magritte kommt hier selber zu Wort und führt den Leser
ein in sein Denken, seine Motivwahl und- deren Bedeutung. Zudem hinterfragt er diese
immer wieder selbst kritisch.
„Die
Nähe zur Philosophie lieferte ihm Argumente für den komplexen Charakter seiner
Bilder. Die diente ihm dazu, seiner Malerei wissenschaftlich zu legitimieren“
Als Magritte-Fan kann ich dieses Buch für alle Magritte-Liebhaber absolut
empfehlen, aber auch für alle, die einen
Blick hinter die Kulissen des Surrealismus werfen möchten.
Alle Theorien Magrittes werden anhand ausgewählter und hochwertiger Bilder
durch kunstvoll gestaltetes Layout in Szene gesetzt und mit spannenden Details
ausgearbeitet. Wirklich kein Wunder, dass Magritte so eine Karriere in der
Kunstgeschichte der letzten Jahrzehnte gemacht hat und eine Inflation auf
Postkarten und Postern durchlebte. Über Tisch und Bett hat das Magritte-Bild stets
die Frage gestellt: Was ist Malerei? Was
Sprache?